Interview
„Wir wollen nicht Teil von Russland sein“
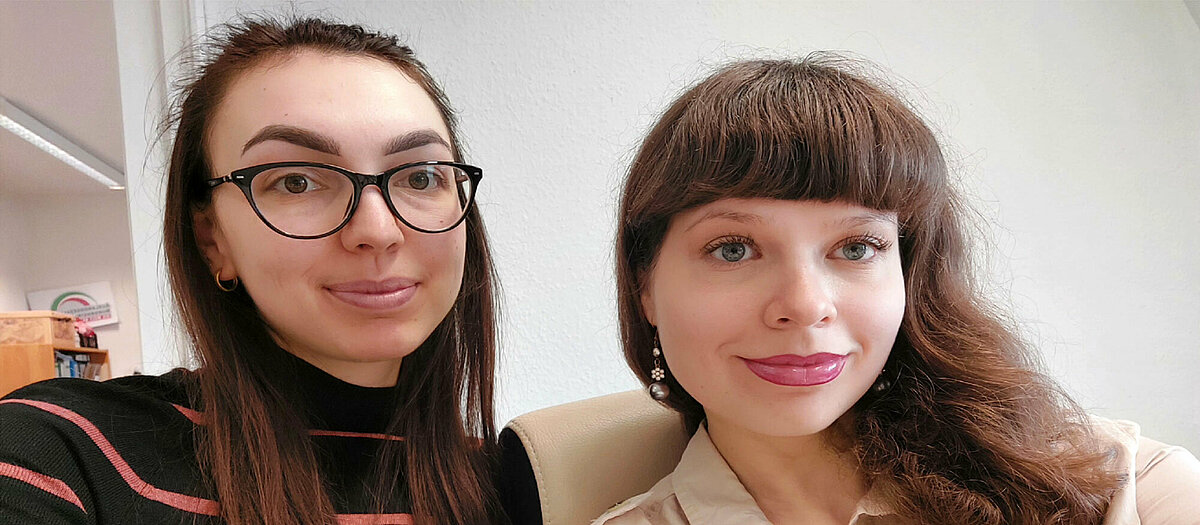
Ivanna Moskaliuk (links) und Christina Bondarenko (rechts)
Ivanna Moskaliuk und Christina Bondarenko aus der Ukraine sind als Langzeitfreiwillige bei der Auslandsgesellschaft in Dortmund. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat sie von ihren Freund*innen und Familien getrennt. Wie gehen sie mit dieser Situation um und was denken sie über den Krieg? IJAB hat mit ihnen darüber gesprochen.
23.03.2022
ijab.de: Ivanna, Christina, wie und wann seid ihr nach Deutschland gekommen?
Ivanna Moskaliuk: Ich bin seit September hier und Christina seit Ende Oktober. Eigentlich war unser Freiwilligendienst schon länger geplant und wir hätten jetzt im März fertig sein sollen, aber durch die Corona-Pandemie hat sich alles verschoben.
Was genau macht ihr bei der Auslandsgesellschaft in Dortmund?
Ivanna Moskaliuk: Wir arbeiten gemeinsam in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Wir unterstützen Veranstaltungen, kümmern uns um die Social-Media-Kanäle und die Internet-Seite oder machen Plakate für die Kommunikation hier im Haus. Außerdem stellen wir Artikel für den hausinternen Pressespiegel zusammen. Die Arbeit ist ziemlich abwechslungsreich und das gefällt mir.
Ihr sprecht sehr gut Deutsch. Habt ihr in der Ukraine Gemanistik studiert?
Ivanna Moskaliuk: Ich habe Deutsch-Ukrainische Übersetzung studiert.
Christina Bondarenko: Und ich bin Deutsch-Lehrerin.
Christinas Kontakt zur Familie ist abgerissen
Habt ihr Kontakt zu euren Familien in der Ukraine? Wie geht es denen, was hört ihr von ihnen?
Christina Bondarenko: Ich habe den Kontakt zu meiner Familie vor drei Tagen verloren. 88% meiner Heimatstadt Tschernihiw sind ohne Wasser und Elektrizität. Als ich zum letzten Mal mit meiner Mutter telefoniert habe, sagte sie mir, ihr Handy-Akku sei fast leer und sie wisse nicht, ob und wo sie ihn wieder aufladen kann. Seither ist der Kontakt abgerissen. Wenn die Leute keinen Strom haben, können sie auch kein Essen mehr zubereiten. Auch meine Familie hat einen elektrischen Herd.
Ivanna Moskaliuk: In Tscherniwzi, wo ich herkomme, ist es verhältnismäßig ruhig. Aber die Menschen befürchten, einzelne Stadtteile könnten bombardiert werden und in der letzten Nacht gab es 5 Stunden lang Luftalarm. Das setzt die Leute unter dauernden Stress. In Tscherniwzi gibt es jetzt sehr viele Flüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine. Freiwillige helfen, sie unterzubringen und über die Grenze nach Rumänien zu bringen.
Christina Bondarenko: In Tschernihiw ist die Situation ganz schlimm. 10-mal am Tag gibt es Luftalarm. Dann müssen meine Verwandten in den Keller. Aber eigentlich ist das kein richtiger Keller, den sie haben, es ist so ein unterirdischer Kühlraum für Gemüse und Obst, wie ihn die Menschen auf den Dörfern haben. Sicher ist das überhaupt nicht. Es gibt kein Wasser, keine Heizung, kein Licht. Die Wasserversorgung wird versucht mit Tankwagen aufrechtzuerhalten. Von dort kann man sich einmal am Tag einen Kanister Wasser holen. Die Situation ist auch deshalb so gefährlich, weil Tschernihiw an der Grenze zu Belarus liegt. Von dort kommen die russischen Raketenangriffe.
In den ersten Kriegstagen haben die Russen gesagt, sie würden nur auf militärische Ziele schießen. Aber das stimmt nicht. Sie bombardieren auch Krankenhäuser und Kindergärten. Letztens ist ein Bus mit Flüchtlingen beschossen worden, obwohl gut sichtbar eine weiße Fahne an ihm angebracht war. Ein russischer Panzer hat einfach ein Auto überrollt, in dem eine ganze Familie saß. In manchen Städten gibt es Demonstrationen gegen die russische Besatzung. Das geht in Tschernihiw nicht, denn der russische Beschuss hört nicht auf. Der Bürgermeister traut sich unter diesen Bedingungen nicht und die Menschen haben Angst, getötet zu werden.
Die russische Armee schießt auf alles
Ivanna Moskaliuk: Es gibt immer wieder Verhandlungen und dann werden humanitäre Korridore versprochen. Aber an diese Vereinbarungen hält sich die russische Armee nicht. Sie schießen auf alles. In Mariupol haben sie sogar eine Geburtsklinik bombardiert.
Ihr seid jetzt hier in Deutschland. Was überwiegt mehr: Das Gefühl in Sicherheit zu sein oder nicht bei euren Familien und Freunden sein zu können?
Christina Bondarenko: Es ist sehr schwer für mich, hier zu sein. Es macht mich depressiv. Meine Familie erzählt mir zwar alles, aber ich kann mir trotzdem nicht richtig vorstellen, wie es ihnen geht. Ich habe an mir unterschiedliche Phasen beobachtet. Erst war ich erschrocken, dann depressiv, dann wütend. Jetzt fühle ich mich hilflos. Immerhin ist meine Schwester jetzt hier. Aber auch das war mit Enttäuschungen verbunden. Ich habe Nachbarn und Bekannte gebeten, meine Schwester mitzunehmen, wenn sie aus Tschernihiw fliehen. Sie sind ohne sie abgefahren. Da habe ich mich sehr hilflos gefühlt.
Ivanna Moskaliuk: Das geht mir auch so. Meine Mutter ist in Italien. Drei Angehörige sind noch in Tscherniwzi. Wenn ich mit ihnen telefoniere, versuche ich sie zu beruhigen. Aber wahrscheinlich beruhigen sie mich mehr, als ich sie. Ich bin hier in Sicherheit und ich sage meinen Verwandten dann das es mir gut geht. Ich kann ihnen ja nicht sagen, dass es mir schlecht geht, wenn ich sehe, wie es ihnen geht.
„Ich bin sehr stolz auf unsere Leute“
Christina Bondarenko: Die Ukrainerinnen und Ukrainer erstaunen mich immer wieder. Ich kenne eine Frau in Tschernihiw, sie ist Pharmazeutin und hilft so ziemlich überall, wo sie kann. Sie spricht sehr gut Deutsch, aber ein Arbeitsangebot aus Deutschland hat sie abgelehnt. Sie möchte lieber etwas dafür tun, damit wir ein unabhängiges Land bleiben. Und die Menschen verlieren auch ihre Freundlichkeit und ihren Humor nicht. Der 8. März, der Internationale Frauentag, ist ein wichtiger Feiertag in der Ukraine. An diesem Tag schenken die Männer den Frauen Blumen. Sie tun das sogar im Krieg, im Bunker. Ich habe ein Foto von einem Blumenladen im Internet gesehen, davor stand eine lange Schlange von Männern, die ihren Frauen Blumen kauften.
Ivanna Moskaliuk: Ich bin sehr stolz auf unsere Leute. Sie posten Sachen, die anderen Mut machen. Sie tun alles, was sie können. Sie setzen starke Zeichen dafür, dass wir es schaffen werden.
Christina Bondarenko: Ich habe ein Meme auf Facebook gesehen mit einem Bild von Peter dem Großen und Putin. „Peter der Große hat das Fenster nach Europa geöffnet, Putin hat es wieder geschlossen“, stand darunter. In Deutschland bekomme ich manchmal so komische Fragen gestellt. Ob es nicht besser sei, sofort aufzugeben und wenigstens am Leben zu bleiben. Niemand in meiner Familie und von meinen Freunden in der Ukraine denkt so. Wir sind keine Russen und wir wollen nicht Teil von Russland sein.
Ivanna Moskaliuk: Mich wundert immer, wenn ich höre, der Krieg hätte gerade vor kurzem begonnen. Wir haben seit 2014 Krieg, das ist nicht neu. Nur in Deutschland hat man das wohl nicht so richtig mitbekommen.
Christina Bondarenko: Wir haben diesen Krieg nicht gewollt. Wir sind keine Selbstmörder, wir hätten Russland nie angegriffen, auch wenn Putin das dauernd behauptet. Aber einen Vorteil haben wir: Die ukrainischen Soldaten kämpfen für die Unabhängigkeit der Ukraine, die russischen Soldaten kämpfen allenfalls für Geld. Wenn sie das nicht mehr bekommen, geben sie auf und desertieren. In Tschernihiw gab es das Hotel Ukraine. Auch das ist zerstört worden. Unser Bürgermeister sagte, „das Hotel Ukraine gibt es nicht mehr, aber die Ukraine gibt es immer noch“. Ja, die Ukraine gibt es immer noch.
Quelle: IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V., Christian Herrmann
Termine zum Thema
-
07.08.2024
A million dreams … a glimpse of tomorrow
-
30.08.2024
Kunsttherapeutisches Gruppenangebot für Kinder (4-7 Jahre) in Hildesheim
-
18.09.2024
kreativ_transformativ – Qualifizierung für eine Kulturelle Bildung mit globaler und nachhaltiger Perspektive 2024/2025
-
20.09.2024
Transformation gewaltzentrierter Männlichkeiten nach bewaffneten Konflikten
-
25.09.2024
Im Dialog – Für Friedensbildung
Materialien zum Thema
-
Anleitung / Arbeitshilfe
Fit for Diversity Card Collection
-
Broschüre
Internationaler Jugendaustausch – Das DPJW-Starterpaket
-
Anleitung / Arbeitshilfe
Neue Methodensammlung zur antisemitismussensiblen Vor- und Nachbereitung deutsch-israelischer Jugendaustauschprogramme
-
Zeitschrift / Periodikum
AFET-Fachzeitschrift Dialog Erziehungshilfe 3-2022
-
Monographie / Buch
Medienerziehung im Dialog
Projekte zum Thema
-
Ahoj.info
-
Perspektive gGmbH Institut für sozialpädagogische Praxisforschung und -entwicklung
Inobhutnahme – Perspektiven: Impulse!
-
AWO Kreisverband Pinneberg e.V. Jugendwerk Unterelbe
Ferienfreizeiten und Sprachreisen mit dem AWO Jugendwerk Unterelbe
-
„Wege zur Erinnerung 2022“ analog, digital oder hybrid
-
Kultur und Art Initiative e.V.
Just like us!
Institutionen zum Thema
-
Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe
AfJ e.V. Kinder-und Jugendhilfe Bremen
-
Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe
Pfad ins Leben gemeinnützige UG
-
Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe
Deutsch-Türkische Jugendbrücke gGmbH
-
Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe
CJG Hermann-Josef-Haus Caritas-Jugendhilfe-Gesellschaft
-
Sonstige
Humana People to People Deutschland e.V.







