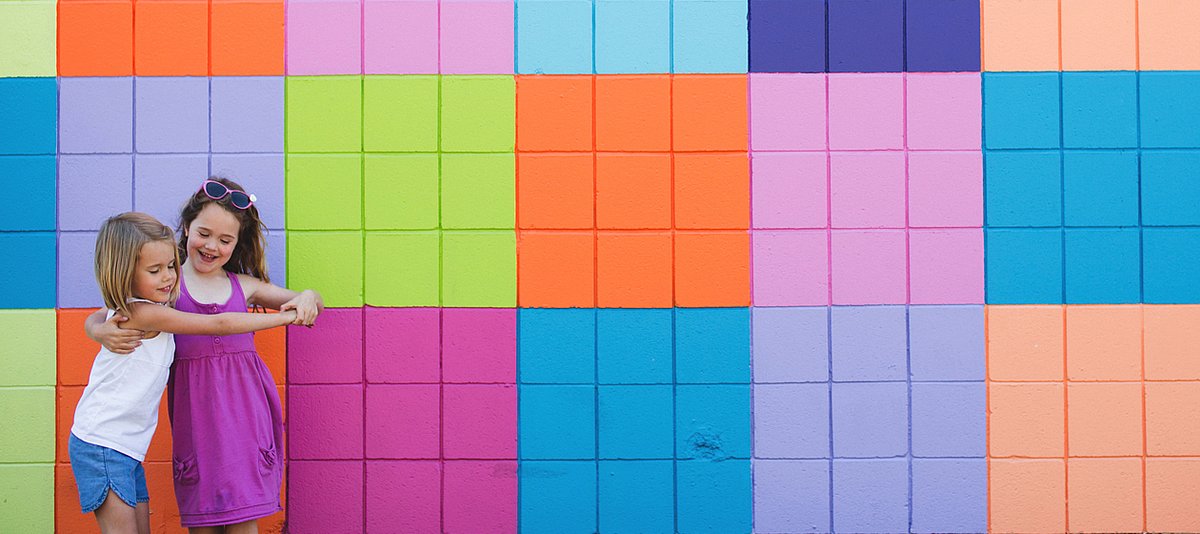Abschlussbericht
Junge Geflüchtete beim Einfädeln in die Berufswelt beraten

Junge Geflüchtete brauchen eine berufliche Perspektive für ihr Leben in Deutschland. Auf ihrem Weg dorthin unterstützen sie vielfältige Beratungsangebote. Welche Herausforderungen sich den Beratenden in den unterschiedlichen Institutionen stellen, erforscht Prof. Dr. Nicole Pötter von der Hochschule München.
02.06.2021
Auf junge Geflüchtete wie sie etwa im Sommer der Migration 2015 nach Deutschland kamen, warten viele Herausforderungen: Deutsch lernen, in einem völlig fremden Land ankommen und beruflich in Deutschland Fuß zu fassen, ist noch eine weitere. Integrationsprogramme unterstützen sie bei ihrer Berufsorientierung bundesweit, die Beratungen der Jugendlichen zwischen 16 und 27 aber finden in den Kommunen statt. Im Vergleich von München, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und Rostock begaben sich Prof. Dr. Nicola Pötter und ihre Kooperationspartner vom Bundesinstitut für Berufsbildung und der Universität Rostock über Interviews mit rund vierzig Berater(inne)n und Führungskräften auf die Spur der unterschiedlichen Beratungsangebote. Wie unterstützen sie junge Geflüchtete bei der Berufswahl?
Eine Vielfalt an Angeboten, widersprechende Beratungsziele
Insgesamt existiert eine große Zahl an offiziellen Beratungsangeboten für die Geflüchteten. Das trifft vor allem auf München zu. Hauptanbieter sind Jobcenter, Kammern und Jungendmigrationsdienste. Gemeinsam ist den Beratenden das Ziel, die jungen Menschen zu einer für sie wirklich umsetzbaren Berufsperspektive zu begleiten. Doch je nach Organisation unterscheiden sich die Beratungsziele: Das Jobcenter will die Jugendlichen fit machen für ein Leben ohne staatliche Unterstützung mit dem Zielpunkt Lehrstelle. Die Berater sind in der Rolle von „Instructoren" tätig. Den Kammern wiederum geht es darum, sie als künftige Fachkräfte für Betriebe zu gewinnen. Sie gehen auf diese als „Recruiter" zu. Jugendmigrationsdienste schließlich haben neben der Berufs- auch die Lebenswelt der Geflüchteten im Blick und verstehen sich eher als „Personal Coaches".
In welcher Rolle die Beratenden auf die Jugendlichen zukommen, macht einen großen Unterschied. Unter anderem in diesen Beraterrollen unterscheiden sich auch die drei so genannten „Gestaltungstypen von Beratung", die das Forschungsteam im Vergleich der Institutionen herauskristallisierte.
Passende Angebote für ein Leben im Zeitraffer
Auch wenn die Anbieter ihre Angebote laufend an die Bedürfnisse der Geflüchteten anpassen – die Berufsorientierung als vordringliches Thema passt oft nicht in deren aktuelle Lebenswirklichkeit. Denn diese führen ein Leben im Zeitraffer: „Einige Beraterinnen nehmen Geflüchtete als Getriebene wahr – durch finanzielle Erwartungen der Herkunftsfamilie oder Erwartungen an Sozialprestige oder den deutschen Arbeitsmarkt", sagt Pötter. Trotz Motivation ist es für sie oft nicht leicht, sich auf langfristige Berufsperspektiven einzulassen.
Doch ihre Lebenswirklichkeiten unterscheiden sich stark. Mürvet Kasap, Teamleitung im Jobcenter München für die Beratung der über 25-jährigen Geflüchteten und Teilnehmerin an Pötters Studie, kennt diese Unterschiede: „Geflüchtete, die bereits früh Familienväter wurden, sind von der Verantwortung her nicht vergleichbar mit Alleinstehenden. Sie nehmen manchmal noch spät eine Lehre auf und das funktioniert gut. Aber wenn Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen, verändern wir unsere Angebote. Das gilt auch für die Coronazeit", sagt Kasap.
Lotsen, damit niemand verloren geht
Neben der Passung der Angebote auf die heterogene Zielgruppe ist die riesige Palette an Angeboten für Pötter eine weitere Herausforderung: "Die Vielfalt ist zu begrüßen, weil sich auch die Lebenslagen der Jugendlichen stark voneinander unterscheiden, aber sie führt zu Abstimmungsproblemen." Das weiß auch Maria Prem, tätig im Bereich bildungs- und beschäftigungsorientierte Integration beim Sozialreferat der Landeshauptstadt München. Sie nahm ebenfalls an der Studie teil und koordiniert im Sozialreferat für die Stadt München die Bildungsangebote für diese Zielgruppe: "Wenn ich einen Jugendlichen in ein Angebot vermittle und er abbricht, dann fällt er, wenn es schiefläuft, aus dem Raster, weil keiner davon erfährt."
Pötter empfiehlt dafür künftig mehr verknüpfende Strukturen einzurichten und Lotsen einzusetzen, eine Funktion, die heute vor allem Ehrenamtliche für die Geflüchteten wahrnehmen. Maria Prem sieht die Münchner Institutionen bereits heute schon auf einem guten Weg: „In München hat sich viel verändert. Es herrscht das Credo, keiner soll verloren gehen. Denn da geht es oft um kostbare Lebensmonate."
Über das Projekt und den Abschlussbericht
Das Projekt BebjG (Chancen des Zugangs zur beruflichen Bildung für bleibeberechtigte junge Geflüchtete) lief vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2020. Beteiligt waren Prof. Dr. Nicole Pötter (Hochschule München), Dr. Bernhard Hilkert (Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn) sowie Prof. Dr. Andreas Diettrich (Universität Rostock). Es wurde gefördert durch das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn. In ihrem Folgeprojekt LokU (Lokale Unterstützungsketten für bleibeberechtigte junge Geflüchtete) untersucht Pötter die Vernetzung professioneller Träger mit den bürgerschaftlichen Akteuren in München.
Der Abschlussbericht kann als PDF eingesehen werden.
Quelle: Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 30.03.2021
Termine zum Thema
-
30.08.2024
Kunsttherapeutisches Gruppenangebot für Kinder (4-7 Jahre) in Hildesheim
-
30.08.2024
Meditative Smartphone- Fotografie für Jugendliche (11-18 Jahre) in Hildesheim
-
30.08.2024
Einstieg in die Elementare Musikpädagogik (EMP)
-
02.09.2024
Kooperations- und Netzwerkarbeit in der Adoptionsvermittlung
-
03.09.2024
Fachkräftequalifizierung "Grenzenlose Jungs*"
Materialien zum Thema
-
Zeitschrift / Periodikum
AFET-Fachzeitschrift Dialog Erziehungshilfe 2-2024
-
Anleitung / Arbeitshilfe
Verfahrenslotsen und Teilhabeberatung (EUTB) – vergleichende Betrachtung und Kooperationsansätze
-
Broschüre
Kinder- und Jugendhilfe in der Krise – Zur Frage der Rechtmäßigkeit pauschaler Standardabsenkung bei (vorläufiger) Inobhutnahme und Hilfegewährung für geflüchtete unbegleitete Minderjährige
-
Stellungnahme / Diskussionspapier
Forderungen zur Europawahl 2024
-
Expertise / Gutachten
JAdigital-Expertise: "Digitalisation of social services for children, young people and families in Denmark""
Projekte zum Thema
-
Netzwerk Kinder von Inhaftierten – Nordrhein-Westfalen
-
AGJF Sachsen e.V.
pro:dis – Distanzierungsberatung in Jugendarbeit und angrenzenden Arbeitsfeldern
-
Medienwerkstatt Potsdam im fjs e.V.
Potsdamer Kinder- und Jugendportal „Hast'n Plan“
-
Cluster Projekte GmbH
Modellprojekt DiKon – Digital in Kontakt sein mit jungen Menschen
-
European Knowledge Centre for Youth Policy
Institutionen zum Thema
-
Sonstige
#180grad Präventionsprojekt
-
Oberste Landesjugendbehörde
Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstsein
-
Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe
Jugendmigrationsdienst Nürnberger Land Internationaler Bund e.V.
-
Hochschule
Hochschule Kempten und KooperationspartnerInnen
-
Sonstige
donum vitae zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens e.V.